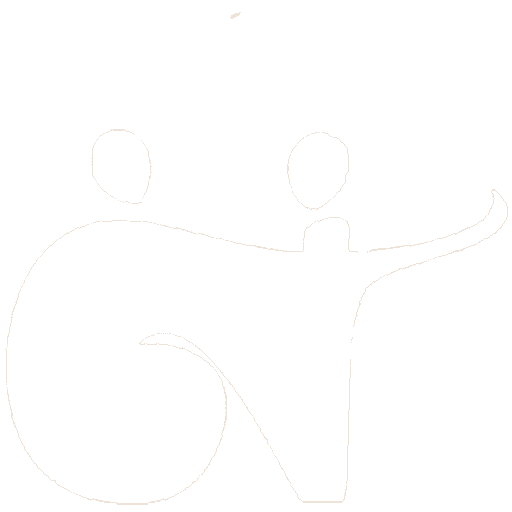Selbstsabotage bedeutet, dass wir uns selbst im Weg stehen – ohne es zu wollen.
Wir sehnen uns nach Erfolg, Zufriedenheit oder Nähe, handeln aber so, dass genau das nicht eintritt.
Das kann sich ganz unterschiedlich zeigen:
-
Wir schieben wichtige Aufgaben immer wieder auf.
-
Wir zweifeln an uns, obwohl andere an uns glauben.
-
Wir fangen Dinge gar nicht erst an oder brechen sie ab, sobald sie gut laufen.
Vor allem auch in Beziehungen neigen viele Menschen zu Selbstsabotage.
Psychologisch lässt sich das in vielen Fällen so erklären: Wer Angst vor Verletzung oder verlassen werden hat, sucht sich oft unbewusst Partner:innen aus, die emotional nicht wirklich verfügbar sind oder deren Lebensentwürfe nicht zu den eigenen passen. So bestätigen wir unsere tief verankerten Überzeugungen wie: „Ich werde abgelehnt.“ oder „Ich bin nicht gewollt.“ – wir rechnen also schon mit Enttäuschung, um nicht enttäuscht werden zu können.
Auf einer unbewussten Ebene fühlt sich dieses Muster vertraut an – auch wenn es weh tut. Indem wir ähnliche Beziehungserfahrungen immer wieder neu erschaffen, bleiben wir in unserer gewohnten, vermeintlich „sicheren“ Rolle: der oder die, die kämpft, sich anpasst oder wartet. So müssen wir uns der Veränderung – und der damit verbundenen Verletzlichkeit – nicht stellen und halten unbewusst an dem fest, was wir kennen.
Manchmal sabotieren wir Nähe auch auf andere Weise: Obwohl – oder gerade weil – eine Beziehung gut läuft, beginnen wir unbewusst, Fehler zu suchen – das berühmte „Haar in der Suppe“. So können wir uns selbst davon überzeugen, dass es besser ist, allein zu bleiben, statt uns der eigenen Verlustangst zu stellen. Auf diese Weise behalten wir die Kontrolle über eine Angst, die wir vermeiden möchten.
Selbstsabotage ist also kein „Fehler“, sondern ein Schutzmechanismus, der früher vielleicht einmal hilfreich war – heute aber oft mehr blockiert als schützt.
Warum wir uns selbst sabotieren?
Die Wurzeln dieser Muster liegen meist in alten Erfahrungen, verinnerlichten Glaubenssätzen oder der tiefen Angst vor Veränderung und (erneuter) Verletzung. Typische Hintergründe sind:
-
Unsichere Bindungserfahrungen in der Kindheit
-
Tiefe Verletzungen aus früheren Beziehungen und damit verbundene Bindungsängste
-
Negative Glaubenssätze (Überzeugungen) wie „Ich bin nicht gut genug“ oder „Ich bin zu viel“
-
Perfektionismus, der nur „alles oder nichts“ kennt
-
Angst vor Versagen oder Erfolg, weil beides Unsicherheit bedeutet
-
Ein geringes Selbstwertgefühl, das verhindert, sich Glück oder Leichtigkeit selbst zu erlauben
Diese inneren Programme laufen oft automatisch ab – bis wir beginnen, sie bewusst wahrzunehmen.
6 Schritte aus der Selbstsabotage
Selbstsabotage lässt sich nicht einfach „wegmachen“. Aber Sie können lernen, sie zu erkennen, zu verstehen und Schritt für Schritt zu verändern.
-
Bewusst beobachten
Achten Sie darauf, wann und wie Sie sich selbst ausbremsen – nicht, um sich zu kritisieren, sondern um zu verstehen, was geschieht. Schon das bewusste Wahrnehmen bringt Bewegung in festgefahrene Muster.
-
Alte Glaubenssätze erkennen
Fragen Sie sich ehrlich: Was glaube ich über mich – und stimmt das wirklich? Oft genügt schon ein Moment der Klarheit, um starre Denkweisen zu lockern.
-
Kleine Schritte statt Perfektion
Warten Sie nicht auf den perfekten Zeitpunkt. Fangen Sie an – auch wenn es sich unsicher anfühlt. Jeder kleine Schritt zählt. Veränderung geschieht selten in großen Sprüngen.
-
Selbstmitgefühl statt Selbstvorwürfe
Wenn der innere Kritiker laut wird, begegnen Sie ihm mit Freundlichkeit. Sagen Sie sich: „Ich darf Fehler machen. Ich darf lernen.“ Selbstmitgefühl ist die Basis für Wachstum.
-
Gesunde Bindungen üben
In Beziehungen ist es wichtig zu erkennen, dass Sie kein passives Opfer Ihrer Muster sind. Sie können aktiv gestalten, wie Sie mit Nähe und Distanz umgehen – und Schritt für Schritt lernen, Vertrauen aufzubauen.Wenn Sie unter Verlustangst leiden, bedeutet Heilung nicht, diese Angst vollständig loszuwerden. Es geht vielmehr darum, mit ihr umzugehen, ohne sich von ihr beherrschen zu lassen. Das gelingt, wenn Sie Ihren inneren Schutzpanzer nach und nach ein wenig öffnen – in Ihrem eigenen Tempo, so weit, wie es gerade möglich ist.
Üben Sie über Ihre Bedürfnisse zu sprechen, auch wenn es Mut kostet. Ihre BeDÜRFnisse DÜRFEN sein. Bleiben Sie präsent, wenn Unsicherheit auftaucht, und schenken Sie sich selbst Halt.
Ein gesundes Bindungsverhalten entsteht nicht durch Perfektion, sondern durch kleine, ehrliche Schritte in Richtung Vertrauen – zu sich selbst und zu anderen.
-
Unterstützung annehmen
Manche Muster sitzen sehr tief. Dann kann es hilfreich sein, mit therapeutischer Begleitung zu verstehen, welche alten Erfahrungen heute noch wirken – und wie Sie sie sanft verändern können.
Raum für Veränderung
In meiner Praxis für Psychotherapie biete ich Ihnen einen geschützten und wertschätzenden Raum, um genau diesen Themen auf den Grund zu gehen. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche, welche inneren Muster Sie bremsen – im Beruf, im Alltag oder in Beziehungen – und finden Wege, wie Sie sich selbst (wieder) vertrauen können.
Mit Achtsamkeit, Klarheit und Mitgefühl begleite ich Sie auf Ihrem Weg zu mehr innerer Sicherheit, Selbstvertrauen und Lebendigkeit.
Der erste Schritt ist bereits getan, wenn Sie beginnen, sich selbst ehrlich und mitfühlend zu begegnen. Genau dort entsteht der Raum, in dem Veränderung, Vertrauen und echte Verbindung möglich werden.
Wenn Sie spüren, dass es Zeit ist, alte Muster zu lösen, bin ich gerne für Sie da 🩷.
Herzliche Grüße,
Ihre Sabine Eymann
Über die Autorin

Sabine Eymann, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Verhaltenstherapeutin, Systemischer Coach und Diplom-Betriebswirtin. Sie war über zwei Jahrzehnte in der Personalentwicklung großer Dax-Konzerne tätig. Heute begleitet sie Menschen in psychisch herausfordernden Situationen und persönlichen Lebenskrisen. Weitere Schwerpunkte liegen u.a. in der Behandlung von Ängsten und Depressionen, unkontrollierten Emotionen, wiederkehrenden Mustern in Beziehungen sowie in der Stärkung von Selbstwert und Selbstmitgefühl.